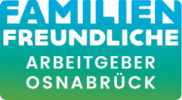Passiva

Die Passivseite der Bilanz zeigt, woher das Geld eines Unternehmens stammt – von Eigentümern oder externen Geldgebern. Sie umfasst Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten und gibt so einen klaren Überblick über die Finanzierungsstruktur und die verfügbaren Mittel.
Passiva erklärt –
Geldgeber, Schulden und Eigenkapital auf einen Blick
Auf der rechten Seite der Bilanz – den sogenannten Passiva – zeigt sich, woher das Unternehmen sein Geld bekommt. Hier steht also nicht, wofür Mittel verwendet werden, sondern wer sie bereitgestellt hat – sei es die Inhaberin selbst oder externe Geldgeber wie Banken. Die Passiva geben damit Aufschluss über die Finanzierungsstruktur eines Betriebs.
Diese Seite ist in mehrere Abschnitte unterteilt –
abhängig davon, wie lange das Geld dem Unternehmen zur Verfügung steht:
- Eigenkapital: Das Geld, das den Eigentümern gehört und dauerhaft im Unternehmen bleibt. Es gibt keinen festen Rückzahlungstermin.
- Rückstellungen: Reserven für künftige Verpflichtungen, etwa für Pensionen oder ungewisse Zahlungen.
- Verbindlichkeiten: Schulden gegenüber Dritten, zum Beispiel Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum zurückgezahlt werden müssen.
- Passive Rechnungsabgrenzung: Vorauszahlungen, die das Unternehmen bereits erhalten hat, aber noch nicht als Leistung erbracht wurden.
Die konkrete Form dieser Übersicht hängt von der Unternehmensform ab –
ein Einzelunternehmen gliedert anders als eine GmbH oder Aktiengesellschaft.
Grundsätzlich gilt: Je später ein Betrag fällig ist, desto weiter unten steht er in der Liste. Und Eigenkapital, das dem Unternehmen auf unbegrenzte Zeit zur Verfügung steht, steht ganz oben – als stabile Basis für alles Weitere.
Digitalisieren Sie Ihre kaufmännischen Prozesse mit HANSALOG MEGA – die Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling. Weitere Informationen finden Sie hier
Eigenkapital -
Was dem Unternehmen wirklich gehört
Das Eigenkapital ist das finanzielle Fundament, auf dem ein Unternehmen steht. Es stammt direkt von den Inhabern oder Gesellschaftern – also jenen, die mit ihrem Geld an das Unternehmen glauben und es vorantreiben wollen. Im Gegensatz zu geliehenem Geld gehört dieses Kapital dem Betrieb selbst. Es ist das Vertrauen in die eigene Stärke – und das finanzielle Rückgrat des Unternehmens.
Bei Kapitalgesellschaften wie der GmbH oder AG sind die Eigentümer verpflichtet, eine bestimmte Summe als Grundausstattung beizusteuern. Dieses sogenannte Stamm- oder Grundkapital wird offiziell in der Bilanz ausgewiesen und stellt den festen Sockel der Finanzierung dar. Darüber hinaus müssen solche Unternehmen auch Rücklagen bilden – finanzielle Polster, die für Sicherheit sorgen und langfristige Stabilität schaffen.
Diese Rücklagen gliedern sich in zwei Hauptkategorien:
- Kapitalrücklagen:
Sie entstehen durch zusätzliche Einzahlungen der Gesellschafter und gehören ebenfalls zum Bereich der Passivseite in der Bilanz.
Sie stärken die finanzielle Substanz des Unternehmens.
- Gewinnrücklagen:
Das ist der Teil des Jahresgewinns, der nicht ausgeschüttet, sondern im Unternehmen behalten wird.
Diese Rücklagen gibt es in unterschiedlichen Formen:
- Gesetzliche Rücklagen: vorgeschrieben für Kapitalgesellschaften
- Rücklagen für eigene Anteile: zum Beispiel, wenn das Unternehmen eigene Aktien hält
- Satzungsmäßige Rücklagen: verankert in der Unternehmenssatzung
- Sonstige Rücklagen: individuell vom Unternehmen gebildete Reserven
für besondere Zwecke
Kurz gesagt:
Eigenkapital ist wie das eigene Werkzeug im Werkzeugkasten –
man muss es nicht zurückgeben, und je mehr davon vorhanden ist, desto besser kann das Unternehmen damit arbeiten.
Rückstellungen –
das finanzielle Sicherheitsnetz
Rückstellungen sind wie ein finanzieller Regenschirm, den Unternehmen aufspannen – für den Fall, dass es irgendwann stürmt. Sie gehören zum Fremdkapital und stehen auf der rechten Seite der Bilanz – den Passiva.
Immer dann, wenn Kosten oder Verpflichtungen drohen, deren genaue Höhe oder Zeitpunkt noch im Dunkeln liegen, wird vorsorglich Geld zurückgelegt. Diese Rückstellungen sind keine Willkür, sondern ein Muss – etwa bei möglichen Pensionsverpflichtungen für Mitarbeitende oder bei unsicheren Risiken, wie rechtlichen Streitfällen oder drohenden Verlusten.
Das Handelsgesetzbuch (§ 249 HGB) schreibt klar vor: Wenn ein Unternehmen mit Ausgaben rechnen muss, die zwar noch nicht fällig sind, aber sehr wahrscheinlich kommen, müssen Rückstellungen gebildet werden.
Einfach gesagt:
Rückstellungen sind wie eine Reserve im Unternehmen – für alle Fälle, die man schon am Horizont sieht, aber noch nicht genau beziffern kann.
Digitalisieren Sie Ihre kaufmännischen Prozesse mit HANSALOG MEGA – die Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling. Weitere Informationen finden Sie hier
Verbindlichkeiten –
wenn ein Unternehmen in der Pflicht steht
Verbindlichkeiten sind die finanziellen Verpflichtungen eines Unternehmens – also Geld, das es noch zahlen muss. Ob offene Rechnungen bei Lieferanten, laufende Kredite bei Banken oder bereits erhaltene Anzahlungen von Kunden:
All diese Positionen zeigen, dass das Unternehmen noch etwas schuldet – und gehören deshalb zu den Passiva, also zur rechten Seite der Bilanz.
Auch Schulden gegenüber Partnerunternehmen oder Beträge, die an Dritte weitergeleitet werden müssen – wie etwa Sozialversicherungsbeiträge – fallen unter diesen Bereich.
Egal, ob kurz- oder langfristig:
Verbindlichkeiten zeigen, wo das Kapital herkommt, das dem Unternehmen aktuell zur Verfügung steht – auch wenn es nicht dem Unternehmen selbst gehört.
Kurz gesagt:
Verbindlichkeiten sind wie offene Versprechen in Zahlenform – sie zeigen, welche finanziellen Zusagen das Unternehmen gegenüber anderen noch einlösen muss.
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten –
Einnahmen mit Blick in die Zukunft
Wenn ein Unternehmen Geld erhält, bevor es die zugehörige Leistung erbracht hat, spricht man von einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Ein klassisches Beispiel:
Mieteinnahmen, die bereits vor Jahresende für das kommende Jahr überwiesen werden. Auch wenn das Geld schon auf dem Konto liegt, darf es noch nicht als Ertrag verbucht werden, da es eine Leistung für die Zukunft betrifft.
Stattdessen wird es zeitlich verschoben:
In der Buchhaltung wird dieser Betrag vom Ertragskonto auf ein separates Abgrenzungskonto gebucht – damit die Einnahmen im richtigen Zeitraum auftauchen.
Moderne Buchhaltungsprogramme übernehmen diese Umbuchungen automatisch und sorgen für eine saubere Bilanzierung.
Wichtig:
Alle Posten auf der Passivseite – also inklusive dieser zeitlich verschobenen Einnahmen – müssen am Ende exakt so hoch sein wie die Aktiva.
Nur dann ist die Bilanz im Gleichgewicht – und das nennt man die Bilanzsumme.
Digitalisieren Sie Ihre kaufmännischen Prozesse mit HANSALOG MEGA – die Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling. Weitere Informationen finden Sie hier